
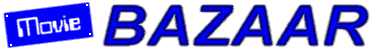
Schindler's List-- Diesmal kein sarkastischer Kommentar -- |
|

|
Regie: Steven Spielberg Darsteller: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Friedrich von Thun Inhalt: Der Fabrikant Oskar Schindler rettet über 1200 Juden vor der Vernichtung. |
|
Kritik: Langsam fährt der Finger über die Landkarte, wo ein Film spielt, ist immer interessant zu erfahren, bis er, einen Fingerbreit von Kattowitz, zwei von Krakau entfernt, hält, dort, wo, wie in Nanking, Hiroshima oder Tschernobyl, Ort und Geschehen so sehr, so tief verwoben sind, daß das eine ohne das andere nie mehr genannt werden kann: Auschwitz. Und so
kommt auch Steven Spielbergs Schindler's List, in
hochqualitativem Schwarzweiß gedreht, nicht an jenem
polnischen Ort vorbei, und dort, wo der still und weiß
fallende Schnee sich mit dem schwarz aufsteigenden Rauch der
Lebendkrematorien vermischt, treten die Schwächen und die
Stärken dieses Films besonders hervor, ganz so, als
hätte auch eine bloße Kulisse, nannte man sie nur
Birkenau, die Macht, Licht und Dunkel messerscharf zu
scheiden. Dazu später mehr. Bald reist
der verfettete, pervers-brutale SS-Untersturmführer Amon
Göth an (Ralph Fiennes in einer seiner besten Rollen
zwischen Sadismus und unterdrückt-eruptiven
Gefühlen) und läßt das Ghetto räumen,
um es in das neu errichtete Konzentrationslager Płaszow
zu verlegen. Der Zuschauer lernt hierbei nicht nur die
vielen, in der Synchronisation mit einem etwas aufgesetzten
jiddischen Akzent sprechenden Akteure näher kennen,
sondern erhält auch einen erstaunlich
erschütternden Einblick in die Fähigkeit des
Menschen, sein eigener Wolf zu sein, seinesgleichen zu
Mozarts Klängen zu töten und jedem Glauben an
Gnade und Mitleid Hohn zu sprechen. Exemplarisch, aber etwas
zu plakativ wird das am Tod des kleinen Mädchens im
roten Mantel klar, das Schindler bei der Räumung des
Ghettos aus den Augen verliert und erst vor den Toren
Krakaus auf dem Scheiterhaufen wiedersieht. Schindler, seiner Arbeiter beraubt und von der Brutalität der Deutschen den Juden gegenüber zunehmend betroffen, sucht nach Wegen, seine Fabrik fortzuführen, und findet sie in der Bestechung Göths und seiner Schergen, die in der Villa oberhalb des Lagers Feste feiern, während die Insassen zutiefst demütigende Selektionen und willkürliche Exekutionen in immer kürzeren Intervallen über sich ergehen lassen müssen. Im Gespräch mit Stern erfährt Schindler nicht nur von den Zuständen in Płaszow, sondern widerlegt zugleich auch moderne Schlußstrich-Anhänger, die behaupten, "man" hätte nichts wissen können, nichts wissen dürfen und "sowieso" nichts tun können. Wieder sind es die scheinbar nebensächlichen Dialoge ("Müssen wir eine neue Sprache erfinden?") und Bilder (die an Ladehemmung scheiternde Exekution! Das Versteck in der Latrine!), die viel mehr als die schauspielerisch und dramaturgisch ausgeschlachteten Stellen (Die "Begnadigungs"-Szene!) aufwühlen und unvergessen bleiben. Schließlich, das Lager wird aufgelöst und nach Auschwitz verbracht, muß Schindler, knapp einem Verfahren wegen angeblicher "Rassenschande" entkommen, seine Listen schreiben, um wenigstens einige wenige Häftlinge in seiner neuen Munitionsfabrik in Brünnlitz in Sicherheit zu bringen. Dennoch wird der Zug mit den Frauen nach Auschwitz fehlgeleitet, und als die Lokomotive im dichten Schneetreiben das berüchtigte Tor passiert, scheint alles verloren. Aber Steven Spielberg wäre nicht Steven Spielberg und Hollywood nicht Hollywood, wenn sich im aussichtslosesten, dramatischsten Moment nicht doch noch alles zum Guten wenden würde. Und als so im Waschraum nur H2O statt HCN aus den Duschen strömt, ist klar, daß es nur gut ausgehen kann, gut ausgehen muß. So scheinen auch die übermenschlichen Schwierigkeiten, die Schindler mit unglaublichem Mut und Glück überwindet, um seine Frauen aus dem Todeslager freizukaufen, nur mehr wie überflüssige Plotstreusel, obwohl das Scheitern an jeder einzelnen Hürde den Tod bedeutet hätte, und auch die unfaßbar glückliche Fügung des Schicksals, daß Schindler es im letzten Moment schafft, die mitgebrachten Kinder vor der Gaskammer zu retten, wirkt so nur wie ein weiterer Schritt auf der breiten Straße zur Freiheit, die doch immer nur ein haardünnes Hochseil im Sturm war. Schindler's List erzählt hier von der Hoffnung inmitten der Hoffnungslosigkeit, von der Rettung inmitten der Rettungslosigkeit, und so tröstlich die Vorstellung ist, daß auch im allgegenwärtigen Morden noch Leben möglich ist, so deplaziert, fast falsch scheint sie hier, wo der Tod zum Meister aus Deutschland wurde, in Birkenau. Kristallen deutlich wird das an der kurzen Szene, als die Schindler-Frauen zum Zug geführt werden, der sie nach Brünnlitz bringt, und dabei an einer langen Reihe Todgeweihter vorbeigehen, die vor der Gaskammer Schlange stehen, als besuchten sie eine Ausstellung. Statt sich selbst zu den toten Lebenden zu stellen und dorthin mitzugehen, wo der Beton an der Decke Kratzspuren menschlicher Finger trägt, folgt die Kamera den Frauen in den Zug, zurück ins Leben, nach Brünnlitz, und vergessen sind die, die gestorben sind, in Auschwitz II. Im Leben sind, anders als in Filmen, Happy-Ends nie ganz und gar glücklich, nie einfach zu erklären, und der mangelhaften Beachtung dieser Tatsache fällt Schindler's List in diesen Szenen zum Opfer. So wirkt auch Schindlers allzu überzeichnete und zu sehr zelebrierte Schlußansprache nicht wie ein kathartisches Finale, sondern nur wie der überflüssig-langweilige Endmonolog des Helden, und die in die Freiheit gehenden Schindler-Juden sehen nicht wie knapp der Ermordung entronnene Folteropfer, sondern wie in den Sonnenuntergang reitende Westernhaudegen aus. Und so ändert auch die letzte Einblendung mit der Zahl nichts an der schlußendlich positiv-herzwarmen Einstellung des Zuschauers, der vermeint, ein weiteres, nur bisweilen tragisches Heldenstück mit vorprogrammiertem Happy-End gesehen zu haben. Das aber wäre nicht nur ungerecht dem bis auf die besprochenen Schwächen sehr gelungenen Schindler's List und seinen wirklich gelebt habenden Protagonisten gegenüber, sondern auch den Menschen hinter der Zahl.
|
|